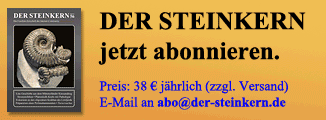Sonstige Bundesländer
Funde von den alten Steinkohlenhalden der Saale-Senke
- Details
- Kategorie: Sonstige Bundesländer
- Veröffentlicht: Sonntag, 24. Januar 2010 17:29
- Geschrieben von Gordon Weiß
- Zugriffe: 22302
Die Aufsammlungen fossiler Pflanzen und Tiere von den alten Steinkohlenhalden der Saale-Senke bei Löbelün, Wettin und Plötz
(in Gedenken an J. Aue † 2007)
von Gordon Weiß im Auftrag von E. Rohrlack
1. Einleitung
In den Jahren 1844 - 1853 verfasste Ernst Friedrich GERMAR sein berühmtes Werk "Die Versteinerungen des Steinkohlengebirges von Wettin und Löbejün im Saalkreis". Es ist heute noch für wissenschaftliche Arbeiten von grundlegender Bedeutung und zeugt zugleich davon, mit welcher Freude unsere Altvorderen arbeiteten.
Wegen der Schönheit und Mannigfaltigkeit jener Karbonpflanzen, wurde schon früh die Aufmerksamkeit der Naturforscher auf das Karbon gerichtet. Viele Arten wurden u.a. von SCHLOTHEIM und Graf STERNBERG beschrieben.
Abb. 1
Ernst Friedrich Germar (1786 - 1853)
Abb. 2
Die Titelseite des Hauptwerkes von Germar aus dem Jahr 1851
Abb. 3
Pecopteris arborea aus GERMAR´s Werk "Die Versteinerungen des Steinkohlengebirges von Wettin und Löbejün im Saalkreis"
2. Stratigrafische Einordnung
Die höchste Serie des Oberkarbons wurde 1893 nach dem Becken von Saint-Etienne im französischen Zentralplateau von Munier-Chalmas und De Lapparent "Stephanien" genannt. Sie umfasst einen Zeitraum von ca. 14 Millionen Jahren. Das Stefanium wird anhand von Pflanzenfossilien in die Sub-Stufen A, B und C gegliedert. Die bis zu 300m mächtige Kohleflöze führende Wettin-Subformation wird ins Stefanium C gestellt. Auf den Halden von Löbejün, Wettin und Plötz werden die vorwiegend schiefrig-tonigen und sandigen Sedimente der sogenannten Graufazies mit den darin vorkommenden fossilen Resten der Flora und Fauna des Karbons gefunden.

Abb. 4
Kleine Halde des Jupp-Angenforth-Schachtes von Löbejün

Abb. 5
Halde des "König Georg Schacht" auf dem Schachtberg bei Wettin

Abb. 6
Alte Kegelhalde von Plötz bei Halle/Saale von der Südwest-Seite gesehen. Höhe ca. 30m
3. Historisches
Die Wettiner lieferten in ferner Vergangenheit nicht nur Markgrafen, Kurfürsten und Königen Steinkohle, sondern von etwa 1700 bis 1740 auch Steinkohle zum Salzsieden nach Halle. Das Wettiner Revier hatte zu dieser Zeit sogar größere technische und wirtschaftliche Bedeutung als die Abbaustätten im Ruhrgebietes. Als dann aber die hallischen Salinen mit der billigeren Braunkohle feuerten, erfolgte ein Rückgang der Steinkohleförderung. Erst als es möglich wurde, die Steinkohle der Wettiner Schächte zu verkoken, kam es wieder zu höheren Fördermengen. Diese für die Bergleute der Region gute Zeit endete dann mit dem Jahr 1872. 1996 ging der ca. 500 Jahre alte Steinkohlenbergbau im Wettiner Revier endgültig zu Ende.

Abb. 7
Bergleute, die jahrhundertelang durch ihre "Knochenarbeit" das "Schwarze Gold" zutage förderten

Abb. 8
Der Farnsamer Odontopteris subcrenulata (ROST) ZEILLER, 1888 ist eine stratigrafische Charakterspezies des Stefanium. Fundort: Löbejün

Abb. 9
Dieser schöne Wedel, von dem beide Plattenseiten vorliegen, ist der Farnsamer Pseudomariopteris busqueti DANZE-COURSIN, 1953. Ebenfalls eine Charakterspezies des Stefanium. Fundort: Löbejün

Abb. 10
Ein großer, eingerollter Farn. Solche Stücke gehören zu den selteneren Funden. Die genaue Zuordnung ist nicht möglich, dürfte aber zur Gattung Pecopteris gehören. Fundort: Lobejün

Abb. 11
Bei diesem kleinen Ausguss des Markhohlraumes eines Calamiten fand evtl. zu Lebzeiten eine Wachstumsstörung der Leitbündel statt. Fundort: Löbejün

Abb. 12
Dieser große Zweig mit mehreren Abzweigungen ist einer der besten Stücke von Asterophyllites equisetiformis aus Löbejün

Abb. 13
Macrostachya infundibuliformis (BRONGNIART) SCHIMPER, 1869. Es handelt sich um einen Fruchtstand von Calamiten. Fundort: Löbejün

Abb. 14
Die Krönung ist dieser komplette Zweig einer Walchia piniformis. Fundort: Löbejün
Abb. 15
Die Süßwassermuschel "Anthracosia" kommt in den Becken der drei Abbaufelder Wettin, Löbejün und Plötz der Saale-Senke vor. Fundort: Löbejün

Abb. 16
Flossenstachel kleiner Haie kommen auf der Halde nicht häufig vor. Neben diesem kompletten Exemplar konnten wir bisher nur ein unvollständiges Stück finden. Fundort: Löbejün

Abb. 17
Hier handelt es sich um einen Oberarm- oder Oberschenkelknochen des kleinen molchähnlichen Branchiosauriers Apateon intermedius WERNEBURG, der bislang nur durch einen kleinen Gaumenknochen von der Halde Löbejün überliefert war. Dieser kleine Amphibienknochen wäre also ein wichtiger zweiter Nachweis dieser sonst aus dem Thüringer Stefan C bekannten Art. Fundort: Löbejün

Abb. 18
Pecopteris arborea. Fundort: Wettin

Abb. 19
Dieser, nasse Standorte liebende Farn Nemejcopteris feminaeformis (SCHLOTHEIM) BARTHEL, 1968 wurde auf der Halde des König Georg Schachtes gefunden. Fundort: Wettin

Abb. 20
Calamites spec. Fundort: Wettin
Abb. 21
Ein Flügel der in der Saale-Senke nicht sehr häufigen Syscioblatta dohrni. Ihr Vorkommen in einer bestimmten Schicht ist ein verläßlicher Anzeiger für das Stefan C. Fundort: Wettin

Abb. 22
Dieser Flügel mit dem Namen Xenoblatta russoma (GOLDENBERG 1869) ist sehr gut erhalten. Er bedurfte keiner weiteren Präparation. Fundort: Wettin

Abb. 23
Nach langer Spekulation wurde dieser Fund als Spinne identifiziert. Eine nähere Einordnung ist jedoch nicht möglich.

Abb. 24
Eine schöne Ranke von Sphenophyllum verticillatum (SCHLOTHEIM) ZEILL. Länge der Ranke ca. 8,0cm. Fundort: Plötz

Abb. 25
Dieser Rindenrest gehört höchstwahrscheinlich zu Lepidophloisos. Bei genauer Betrachtung sind die Leitbündelnarben zu erkennen. Fundort: Plötz

Abb. 26
Zu den verschiedenen Pflanzen gehören auch deren Samen. Dieses Bild zeigt einen Flugsamen von Lepidodendron, der den Namen Lepidostrobophyllum lanceolatum trägt. Als rezenter Vergleich dazu ein Flugsamen unseres heimischen Ahorns. Länge des fossilen Flugsamens 3,5cm. Fundort: Plötz

Abb. 27
Ebenfalls ein samaropsisähnlicher Flugsamen. Daneben ein Lepidostrobophyllum lanceolatum. Fundort: Plötz

Abb. 28
Hier handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Zapfen unbekannter Zugehörigkeit. Länge ca. 2,0cm. Fundort: Plötz

Abb. 29
Vor etwa 20 Jahren gelang der Fund dieser Schiefertonplatte mit der fossilen Haifisch-Eikapsel Palaeoxyris helicteroides. Die Haie legten ihre Eikapseln an den Rändern der lacustrinen Gewässer zwischen den teilweise unter Wasser befindlichen Wurzeln der Schachtelhalme ab. Calamiten säumten damals die Ufer. Über der Kapsel ist ein solcher Wurzelrest zu erkennen. Die steinkohlezeitlichen Selachier müssen, um diese Laichgebiete zu erreichen, weit flussaufwärts geschwommen sein. Die Eikapsel ist 10,5cm lang. Interessant ist, dass diese Fossilien von Ernst Friedrich GERMAR 1851 als Fruktifikationen zu den Restiaceen, einer Familie der bedecktsamigen Pflanzen (Angiospermen), gestellt wurde und erst fast 100 Jahre später ihre Zugehörigkeit ins Tierreich als gesichert galt. Das Beispiel zeigt, wie sich Zuordnungen und Bestimmungen fossiler Reste im Verlauf der wissenschaftlichen Forschung grundsätzlich verändern können. Fundort: Plötz

Abb. 30
Im Jahre 2000 wurde diese Platte mit zwei Haikapseln gefunden. Die Haie legten ihre Eikapseln in Bündeln bis 4 Stück ab. Aber eine Platte mit 2 Kapseln ist eine Seltenheit. Sie erhielt deshalb einen eigenen Aufbewahrungskasten. Die Größe der Platte beträgt 30x25cm

Abb. 31
Das Bild zeigt die beiden Haikapseln aus Abb. 30. Sie gehören ebenfalls zu Palaeoxyris helicteroides. Wie ein Hinweis aud die flussufer- bzw. gewässernahen Lebensräume der Schachtelhalme, in deren Nähe die Haie ihre Eikapseln ablegten, liegt genau zwischen den beiden Kapseln ein schöner Zweig von Asterophyllites equisetiformis. Weitere Reste davon sind an den Plattenrändern zu erkennen. Die Eikapseln sind 8,0 und 7,5cm lang. Fundort: Plötz

Abb. 32
Und so kann auch ein Arbeitsplatz aussehen.

Abb. 33
Dies ist J. Aue bei seiner "fast" täglichen Arbeit im Stefan, bevor er leider von uns ging. Dank seiner mühevollen Arbeit, zusammen mit seiner Frau (E. Rohrlack), haben wir jetzt einen besseren Einblick in das Oberkarbon von Sachsen-Anhalt und damit auch eine gute Basis für weitere wissenschaftliche Arbeiten auf diesem Gebiet.
Fazit
Die Schönheit der fossilen Reste ist bestimmt nur ein Grund dafür, dass sich Sammler in der letzten Zeit immer häufiger den 300 Millionen Jahren alten Wundern der Natur zuwenden. Wer mit unermüdlichem Eifer die alten Halden aufsucht, wird sicherlich die selbe Freude haben, wie sie einst GERMAR vor 150 Jahren hatte.
Sammlung und Fotos: Jochen Aue und Elisabeth Rohrlack