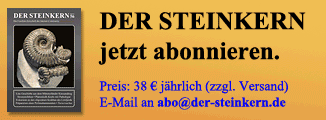Nordrhein-Westfalen
Vom Santon in die Eisenzeit, oder: Wie eine Fossilienexkursion zum archäologischen Glücksfall wurde
- Details
- Kategorie: Nordrhein-Westfalen
- Veröffentlicht: Montag, 28. Februar 2011 01:52
- Geschrieben von Grenzton
- Zugriffe: 13586
Im Jahre 2007 bekam ich die Information über eine Baustelle bei Lüdinghausen. Dort wurde das zu schmal gewordene Bett des Dortmund-Ems-Kanals um mehrere Meter verbreitert und der Aushub links und rechts des Kanals aufgeschüttet.

Abb. 1: Der Kanal mit neuem Ufersaum
Da es sich um Nassbaggerei handelte, waren die Sedimente mit Wasser zu einem Mergelbrei vermengt. An manchen Stellen wurden Sammelbecken ausgebaggert, die einige fossilführende Horizonte anschnitten.
Lithologie
Hier lagern Tonmergel, die dem Obersanton zuzuordnen sind. Sie sind schwach verfestigt und verwandelten sich nach den starken Regenfällen in diesem Jahr zu kaum zu überwindenden Morastflächen. Überlagert werden sie von Resten des Münsterländer Kiessandzuges, der hier einen kleinen Ausläufer hinterlassen hat. Darin fanden sich zahlreiche Feuersteinknollen und nordische Granitfindlinge.

Abb.2: Die Fundstelle; links die Halde mit dem Oberkreidematerial.

Abb. 3: Weitläufige abgeschobene Ackerfläche.
In der Hauptsache fanden sich Rostren von Belemniten (Abb. 4), Austern, isolierte Seeigelplatten und Inoceramenbruchstücke. Bemerkenswert sind die verhältnismäßig zahlreichen Funde von Solitärkorallen der Gattung Parasmilia (Abb. 7).

Abb. 4: Belemnitenrostren von Gonioteuthis quadrata (Exempl. 1 + 2) und Actinocamax verus (Exempl. 3 + 4).

Abb.5: Gonioteuthis quadrata granulata.

Abb.6: Gonioteuthis quadrata granulata mit erhaltener Oberflächenstruktur.

Abb. 7: Parasmilia sp., Solitärkorallen.
Abb.8: Austern, die sich einen Kieselschwamm zum Anheften gesucht haben.
Bei meiner Suche nach Fossilien streifte ich auch über die weiten abgeschobenen Ackerflächen, dort fanden sich einige Säugertierknochen und Zähne.
Abb. 9: Phalange von Equus germanicus.
Feiner mergeliger Sand wechselte sich mit Sandmergel ab, als mir einige sehr dunkle Bodenverfärbungen auffielen. In den dunklen Bereichen lagen auffallend viele Keramikscherben, die so ganz anders aussahen, als man das gewohnt war. Ich begann alles einzusammeln was an der Oberfläche lag, bis ich auf ein kleines beschädigtes Walzenbeil (Abb. 10) stieß, da wurde mir klar, dass es ab jetzt archäologisch werden würde.

Abb.10: Walzenbeil aus Amphibolit. Dieses Steinbeil wird auf das Jungneolithikum (ca. 3000 v. Chr.) datiert.

Abb. 11: Keramikscherben in situ.

Abb.12: Gebrauchskeramik aus der Eisenzeit.
Am folgenden Tag benachrichtigte ich das Amt für Archäologie. Wir vereinbarten einen Termin am nächsten Tag. Meine Funde brachte ich gleich mit und präsentierte sie den Archäologen. Bereits die erste Bestimmung lautete für die Keramik gleich auf "Eisenzeit" (ca. 600 v. Chr.). Nach Absprache mit der Baufirma wurde umgehend eine Notgrabung eingeleitet. Ein etwa 1500 Quadratmeter großes Areal wurde flach abgezogen und kartographisch festgehalten.
Es konnten zahlreiche Pfostenlöcher und Gruben identifiziert werden, sowie der Uferbereich eines ehemaligen Gewässers.

Abb. 13: Diese Bodenverfärbungen deuten auf ein ehemaliges Gewässer hin.
Bei der Grabung durfte ich aktiv mithelfen und so konnte alleine ich, über 600 Keramikscherben bergen (Abb. 14), eine halbe blaue Glasperle und ein bronzenes Armreif-Fragment auflesen. Aufgrund der besonderen Bodenbeschaffenheit bzw. durch den hohen Anteil an Kalkmergel konnten sich die zahlreichen Knochen über die Jahrtausende erhalten. Dieser Umstand verhalf dieser Fundstelle erst zu seiner besonderen Bedeutung.

Abb. 14: Zirka 600 Keramkfragmente und Knochen.

Abb.15: Knochen in situ.

Abb.16: Knochen und Zähne eisenzeitlicher Säugetiere.
Der ausgebaggerte Boden wurde an einen anderen Ort verbracht um dort in Ruhe ausgesiebt zu werden (Abb. 18).
Auch hier kamen ungewöhnlich viele Knochen und Zähne zum Vorschein.
Insgesamt konnten bei der Siebaktion über 10 000 Keramikscherben, etwa 900 Knochenfragmente (ausschließlich Langknochen von Pferd, Rind, Schaf, Hirsch, Schwein, Ziege, Hund) gesichert werden.
Des Weiteren fand man mehrere mehrreihige blaue Glasarmreife, die eine Datierung auf die letzten drei Jahrhunderte vor Chr. ermöglichten.
Eine C14 Analyse von verbrannten Tierknochen ergab eine engere Datierung von 560 +/- 126 Jahre v. Chr.
Ein ganz besonderer Fund war ein Spinnwirtel (D: 2,5 cm) aus Bronze - solche Wirtel sind nur aus Dänemark bekannt und weisen auf einen höheren Status des Besitzers hin. Dieser Fund ist für Westfalen einzigartig.
Alles in allem kann gesagt werden, dass es sich hier um eine sehr frühe Art von Müllentsorgung an bzw. in einem Gewässer handelt.
Da sich eine große Menge von zertrümmerten Knochen ohne jedes Gelenk aufsammeln ließ, legt dies die Vermutung nahe, dass es sich bei diesem Fundplatz um eine eisenzeitliche Leimsiederei gehandelt haben muss.
Die vielen Regentage während der Grabung haben uns einen sehr authentischen Eindruck der damaligen Verhältnisse simuliert (Abb. 17).
Auch hier kamen ungewöhnlich viele Knochen und Zähne zum Vorschein.
Insgesamt konnten bei der Siebaktion über 10 000 Keramikscherben, etwa 900 Knochenfragmente (ausschließlich Langknochen von Pferd, Rind, Schaf, Hirsch, Schwein, Ziege, Hund) gesichert werden.
Des Weiteren fand man mehrere mehrreihige blaue Glasarmreife, die eine Datierung auf die letzten drei Jahrhunderte vor Chr. ermöglichten.
Eine C14 Analyse von verbrannten Tierknochen ergab eine engere Datierung von 560 +/- 126 Jahre v. Chr.
Ein ganz besonderer Fund war ein Spinnwirtel (D: 2,5 cm) aus Bronze - solche Wirtel sind nur aus Dänemark bekannt und weisen auf einen höheren Status des Besitzers hin. Dieser Fund ist für Westfalen einzigartig.
Alles in allem kann gesagt werden, dass es sich hier um eine sehr frühe Art von Müllentsorgung an bzw. in einem Gewässer handelt.
Da sich eine große Menge von zertrümmerten Knochen ohne jedes Gelenk aufsammeln ließ, legt dies die Vermutung nahe, dass es sich bei diesem Fundplatz um eine eisenzeitliche Leimsiederei gehandelt haben muss.
Die vielen Regentage während der Grabung haben uns einen sehr authentischen Eindruck der damaligen Verhältnisse simuliert (Abb. 17).

Abb. 17: Der regenreiche Sommer ließ das Grabungsareal zum Morastloch werden.

Abb. 18: Das Material wurde in einer Notgrabung gesichert und abtransportiert.
Dieser Bericht soll allen Sammlern und Suchern aufzeigen, dass es bei der Suche nach Fossilien sehr schnell mal in die archäologische „Abteilung“ gehen kann - also: immer die Augen offen halten und nicht zögern die Behörden einzuschalten.
Für mich hat sich daraus eine seither andauernde Zusammenarbeit mit der Bodendenkmalpflege ergeben.
Dieser Bericht soll allen Sammlern und Suchern aufzeigen, dass es bei der Suche nach Fossilien sehr schnell mal in die archäologische „Abteilung“ gehen kann - also: immer die Augen offen halten und nicht zögern die Behörden einzuschalten.
Für mich hat sich daraus eine seither andauernde Zusammenarbeit mit der Bodendenkmalpflege ergeben.
Danksagung
Mein Dank gilt
- Dr. Gaffrey, vom LWL-Archäologie Westfalen
- Herrn Esmyol, vom LWL-Archäologie Westfalen
- sowie der Firma Reinhold Meister GmbH
- Dr. Gaffrey, vom LWL-Archäologie Westfalen
- Herrn Esmyol, vom LWL-Archäologie Westfalen
- sowie der Firma Reinhold Meister GmbH