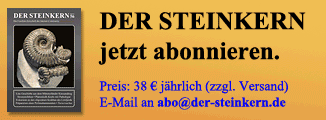Niedersachsen
Die Fossilien des Steinbruchs am Kahnstein bei Langelsheim
- Details
- Kategorie: Niedersachsen
- Veröffentlicht: Dienstag, 17. März 2009 00:48
- Geschrieben von Udo Resch
- Zugriffe: 15410
Im Kahnstein, einer Erhebung die der Harz-Nordrandstörung folgt, ist ein kleiner Steinbruch angelegt, der im Laufe der Jahre eine hübsche Bandbreite an Fossilien des oberen Turons geliefert hat.
Gleich an dieser Stelle!
Das Betreten des Bruches ist verboten. Nach meinem Kenntnisstand werden auch keine Genehmigungen zum Begehen mehr erteilt, da sich auf dem Bruchgelände auch archäologische Güter finden.
Stratigraphie
An dieser Stelle reicht die Stratigraphie vom Alb bis mindestens in das Coniac hinein. Der Steinbruch erschließt Schichten des Oberen Turon, vermutlich bis in das Coniac.
Ansich ist der Steinbruch ziemlich fossilleer. Lediglich das Hyphanthoceras – Event liefert - wenn mal aufgeschlossen - eine Fauna, die der von Halle am Teutoburger Wald in weiten Bereichen ähnelt.
Lithologie
Wie in Halle liegen Flaserkalke vor, deren Bänke stark wellig sind und in der Mächtigkeit deutlich schwanken. Einzelne Horizonte lassen sich schwer verfolgen. Die Matrix enthält deutlich mehr Kalk als in Halle, und die in den Kalken enthaltenen Fossilien trennen erheblich schlechter. Meist trennen sie so schlecht, dass sich kaum fehlerfreie Steinkerne gewinnen lassen.
Fossilien
Echinodermen, also Seeigel, sind in der Regel schlecht erhalten, meist verdrückt oder nur fragmentarisch überliefert.
Ammoniten stellen den Hauptteil der vorkommenden Fossilien. Subprionocyclen kommen deutlich häufiger vor als in Halle, Hyphanthoceraten hingegen treten deutlich zurück. Selbiges gilt für Eubostrychoceras. In all den Jahren fand ich nur ein brauchbares Exemplar (unter Berücksichtigung der schlechten Erhaltungsbedingungen)!
Überraschungen finden sich bei den Scaphiten! Neben Scaphites geinitzi findet sich noch Scaphites diana und auch Scaphites kieslingswaldense, der eigentlich erst im Coniac auftreten sollte. Eine Klärung dieser Fragestellung ist noch nicht in Sicht.
Auch Pseudojacobites farmery erscheint erheblich häufiger vorzukommen. Besonders an ihm sind die löffelförmigen Stacheln, die mir so erhalten bislang von keiner anderen Fundstelle bekannt sind.
Nautiliden, auch wenn keine abgebildet sind, scheinen häufiger zu sein. Sie sind aber in der Regel fragmentarisch erhalten.
Als Besonderheit sind an dieser Lokalität Aptychen organisch erhalten, die man in Halle vergeblich sucht. Es konnten mindestens 3 Typen unterschieden werden
Porifera oder Schwämme. Das ist in meinen Augen der eigentliche Höhepunkt dieser Lokalität. Hier kommen Schwämme in einer hohen Vielfalt körperlich erhalten vor, die sich unter hohem Aufwand sogar freilegen lassen. Allerdings erfolgt die Präparation aufgrund der hohen Reinheit des Kalkes auf Farbumschlag, denn vielfach trennen sie nicht auf der Oberfläche. Einige Exemplare konnten mit Stiel und Wurzel geborgen und freigelegt werden.
Gastropoden kommen hier, vermutlich wegen der Ufernähe, häufiger vor und durch den reinen Kalk zeigen sie häufig noch sehr feine Oberflächenstrukturen, die in mergeligeren Lokalitäten oft verloren gehen. Pleurotomarien, Kegelschnecken und auch Pelikanfüße konnten nachgewiesen werden.


Abb. 1 und 2: Pseudojacobites farmery, 4 cm

Abb. 3: Hyphanthoceras und Einzelkoralle (1,8 cm)

Abb. 4: Schwamm Ventriculites? ,13 cm

Abb. 5: Becherschwamm, 5,5 cm.

Abb. 6: Unbestimmter Schwamm 10,5 cm


Abb. 7 & 8: Eubostrychoceras saxonicum, 6,6 cm

Abb. 9: Scaphites sp., 4,70 cm

Abb. 10: Großporiger Schwamm, 6,5 cm


Abb. 11-13: Tellerschwamm, 6,7 cm


Abb. 14: Trichterschwamm, 5,5 cm

Abb. 15: Scaphites kieslingswaldense, Größe 3,7 cm

Abb. 16: Scaphites geinitzi, 5,4 cm

Abb. 17: Ottoscaphites sp., 2,20 cm

Abb. 18: Scaphites kieslingswaldense, 3 cm

Abb. 19: Scaphites kieslingswaldense, 3,5 cm

Abb. 20: Pleurotomaria sp. 4 cm

Abb. 21: Lewesiceras paramplus, 9 cm

Abb. 22: Subprionocyclus sp., 3 cm

Abb. 23: Bryozooenkolonie, 2,3 cm

Abb. 24: Echinocorys sp., 6 cm


Abb. 25 & 26: Micraster sp., 4 cm


Abb. 27: Infulaster sp., 4 cm

Abb. 28: Aptychen 1,50 cm

Abb. 29: Puzosia sp. 8,2 cm

Abb. 30: Cidaris sp., 25x17cm Platte

Abb. 31: Allocrioceras sp., 5 cm

Abb. 32: Becherschwamm, 8 cm
Sammlungsfotos




Die über einen Zeitraum von über 10 Jahren zusammengetragene Sammlung wurde an ein Paläontologisches Institut übergeben, geblieben ist das Material auf den Fotos in der Vitrine. Eine wissenschaftliche Bearbeitung ist angedacht, steht bislang aber aus.
Udo Resch
Gleich an dieser Stelle!
Das Betreten des Bruches ist verboten. Nach meinem Kenntnisstand werden auch keine Genehmigungen zum Begehen mehr erteilt, da sich auf dem Bruchgelände auch archäologische Güter finden.
Stratigraphie
An dieser Stelle reicht die Stratigraphie vom Alb bis mindestens in das Coniac hinein. Der Steinbruch erschließt Schichten des Oberen Turon, vermutlich bis in das Coniac.
Ansich ist der Steinbruch ziemlich fossilleer. Lediglich das Hyphanthoceras – Event liefert - wenn mal aufgeschlossen - eine Fauna, die der von Halle am Teutoburger Wald in weiten Bereichen ähnelt.
Lithologie
Wie in Halle liegen Flaserkalke vor, deren Bänke stark wellig sind und in der Mächtigkeit deutlich schwanken. Einzelne Horizonte lassen sich schwer verfolgen. Die Matrix enthält deutlich mehr Kalk als in Halle, und die in den Kalken enthaltenen Fossilien trennen erheblich schlechter. Meist trennen sie so schlecht, dass sich kaum fehlerfreie Steinkerne gewinnen lassen.
Fossilien
Echinodermen, also Seeigel, sind in der Regel schlecht erhalten, meist verdrückt oder nur fragmentarisch überliefert.
Ammoniten stellen den Hauptteil der vorkommenden Fossilien. Subprionocyclen kommen deutlich häufiger vor als in Halle, Hyphanthoceraten hingegen treten deutlich zurück. Selbiges gilt für Eubostrychoceras. In all den Jahren fand ich nur ein brauchbares Exemplar (unter Berücksichtigung der schlechten Erhaltungsbedingungen)!
Überraschungen finden sich bei den Scaphiten! Neben Scaphites geinitzi findet sich noch Scaphites diana und auch Scaphites kieslingswaldense, der eigentlich erst im Coniac auftreten sollte. Eine Klärung dieser Fragestellung ist noch nicht in Sicht.
Auch Pseudojacobites farmery erscheint erheblich häufiger vorzukommen. Besonders an ihm sind die löffelförmigen Stacheln, die mir so erhalten bislang von keiner anderen Fundstelle bekannt sind.
Nautiliden, auch wenn keine abgebildet sind, scheinen häufiger zu sein. Sie sind aber in der Regel fragmentarisch erhalten.
Als Besonderheit sind an dieser Lokalität Aptychen organisch erhalten, die man in Halle vergeblich sucht. Es konnten mindestens 3 Typen unterschieden werden
Porifera oder Schwämme. Das ist in meinen Augen der eigentliche Höhepunkt dieser Lokalität. Hier kommen Schwämme in einer hohen Vielfalt körperlich erhalten vor, die sich unter hohem Aufwand sogar freilegen lassen. Allerdings erfolgt die Präparation aufgrund der hohen Reinheit des Kalkes auf Farbumschlag, denn vielfach trennen sie nicht auf der Oberfläche. Einige Exemplare konnten mit Stiel und Wurzel geborgen und freigelegt werden.
Gastropoden kommen hier, vermutlich wegen der Ufernähe, häufiger vor und durch den reinen Kalk zeigen sie häufig noch sehr feine Oberflächenstrukturen, die in mergeligeren Lokalitäten oft verloren gehen. Pleurotomarien, Kegelschnecken und auch Pelikanfüße konnten nachgewiesen werden.


Abb. 1 und 2: Pseudojacobites farmery, 4 cm

Abb. 3: Hyphanthoceras und Einzelkoralle (1,8 cm)

Abb. 4: Schwamm Ventriculites? ,13 cm

Abb. 5: Becherschwamm, 5,5 cm.

Abb. 6: Unbestimmter Schwamm 10,5 cm


Abb. 7 & 8: Eubostrychoceras saxonicum, 6,6 cm

Abb. 9: Scaphites sp., 4,70 cm

Abb. 10: Großporiger Schwamm, 6,5 cm


Abb. 11-13: Tellerschwamm, 6,7 cm


Abb. 14: Trichterschwamm, 5,5 cm

Abb. 15: Scaphites kieslingswaldense, Größe 3,7 cm

Abb. 16: Scaphites geinitzi, 5,4 cm

Abb. 17: Ottoscaphites sp., 2,20 cm

Abb. 18: Scaphites kieslingswaldense, 3 cm

Abb. 19: Scaphites kieslingswaldense, 3,5 cm

Abb. 20: Pleurotomaria sp. 4 cm

Abb. 21: Lewesiceras paramplus, 9 cm

Abb. 22: Subprionocyclus sp., 3 cm

Abb. 23: Bryozooenkolonie, 2,3 cm

Abb. 24: Echinocorys sp., 6 cm


Abb. 25 & 26: Micraster sp., 4 cm


Abb. 27: Infulaster sp., 4 cm

Abb. 28: Aptychen 1,50 cm

Abb. 29: Puzosia sp. 8,2 cm

Abb. 30: Cidaris sp., 25x17cm Platte

Abb. 31: Allocrioceras sp., 5 cm

Abb. 32: Becherschwamm, 8 cm
Sammlungsfotos




Die über einen Zeitraum von über 10 Jahren zusammengetragene Sammlung wurde an ein Paläontologisches Institut übergeben, geblieben ist das Material auf den Fotos in der Vitrine. Eine wissenschaftliche Bearbeitung ist angedacht, steht bislang aber aus.
Udo Resch